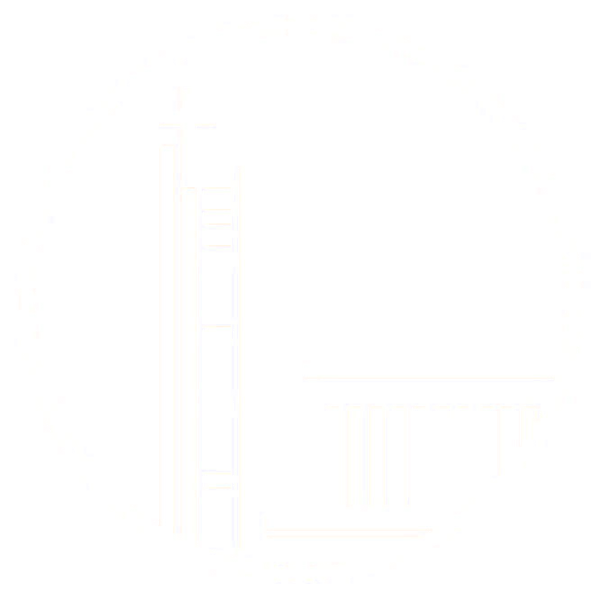Lesepredigt zum Mitnehmen
3. Sonntag nach Trinitatis, 28. Juni 2020
Evangelium: Lukas 15, 11-24 Der verlorene Sohn
Predigt: Micha 7, 18.19
Liebe Gemeinde,
Schuld sind immer nur die Anderen.
Es ist doch wie bei dem Kartenspiel „Schwarzer Peter“. Ziel des Spiels ist, dass der „Schwarze Peter“ nicht in den eigenen Händen bleibt. Man versucht ihn so schnell wie möglich los zu werden.
Die Schuldfrage spielt eine große Rolle! Wenn ein Unglück passiert, dann wird schnell gefragt: Wer war schuld?
Natürlich muss diese Frage beantwortet werden und alles dafür getan werden, dass so ein Unglück nicht noch einmal passiert.
Wichtiger als die Schuldfrage ist es jedoch, das Schlimme, was da geschehen ist erst einmal miteinander auszuhalten.
Denken Sie an die Love-Parade-Katastrophe: 21 Menschen verstarben; 541 Menschen wurden schwer verletzt; viele Tausend sind bis heute dauerhaft seelisch belastet.
Der damalige Oberbürgermeister Duisburgs wies alle Schuld von Anfang an von sich – wie auch der Veranstalter. „Ich bin nicht schuld!“
Wie anders wäre es auch für die Angehörigen der zu Tode gekommenen gewesen, wenn er sich eine Kerze genommen und sich zu den Trauernden und Schockierten gestellt hätte und das Unfassbare, was da geschehen ist ausgehalten hätte mit den anderen zusammen.
Später hätte man immer noch über die Verkettung von Falschentscheidungen und Fehlverhalten sprechen können und darüber, wer alles daran mit schuld war.
Die Schuld einfach zu verdrängen war völlig falsch.
Ich bin nicht schuld! Das meinen auch viele von uns und verweisen auf die Verhältnisse, in denen wir leben.
Ich bin nicht schuld. Meine Kindheit und das Umfeld haben mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Und das stimmt ja auch irgendwie. Aber es rechtfertigt nicht falsches Verhalten.
Mit den Worten „Ich bin unschuldig!“ versucht man sich zu distanzieren. Dabei weiß man doch genau: Wenn ich mit dem Finger auf andere zeige, weisen drei Finger meiner Hand auf mich selbst zurück!
Je älter wir werden, umso mehr wird uns bewusst, dass wir vor anderen schuldig werden.
Wir verletzen andere durch Worte, die uns so herausrutschen, flapsig ausgesprochen.
Wir werden schuldig vor anderen, weil wir ihnen durch unser Verhalten nicht die nötige Wertschätzung entgegenbringen.
Wir werden schuldig vor unseren Kindern, weil wir zu lasch oder zu streng sind, weil wir uns zu viel oder zu wenig um sie kümmern. Wir werden schuldig, weil wir Menschen sind mit all den Fehlern und Fehlentscheidungen.
Wir werden schuldig an dieser Welt, weil wir so leben wie wir leben und die Erde durch unseren Konsum ausbeuten. Unser Wohlstand ist zum Großteil auf Unterdrückung anderer aufgebaut. Damit laden wir Schuld auf uns.
Und auch das erfahren wir in unserem Leben: Es gibt manche Entscheidungen, die so komplex sind, dass die Kategorien im Sinne von „gut oder schlecht“ oder „richtig oder falsch“ nicht ausreichen. Da gibt es nicht nur die eine „richtige“ Entscheidung.
Wir werden schuldig vor Gott, weil wir nicht so leben, wie es seinem Willen entspricht.
Davon erzählt die Bibel in vielen Geschichten. Sie erzählt davon, wie Menschen das Recht untereinander beugen und sich damit von Gottes Willen entfernen. Sie erzählen davon, dass wir Gott nicht vertrauen, sondern ihm misstrauen, dass er es gut mit uns meint.
Schon vor 2700 Jahren prangerte der Prophet Micha im Südreich Israels die sozialen Missstände an. Die Reichen und Machthaber rauben das Land und leben auf Kosten der Armen. Sie bringen sie um ihr Recht. Micha kündigt daraufhin im Namen Gottes das Gericht an. Er sagt: Euer Handeln hat Konsequenzen. Ihr könnt nicht einfach tun was ihr wollt. Gott wird euch richten.
Aber dann spricht er auch so von Gott: „Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übriggeblieben sind von seinem Erbteil; der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig!
Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen.“ (Micha 7, 18.19.)
Die Vergebung ist am Ende größer als die Schuld.
Jesus hat Gottes Vergebung gelebt in Wort und Tat bis zu seinem Tode am Kreuz. So hat er Menschen an Leib und Seele geheilt. Das Kreuz, das als Symbol an vielen Orten zu finden ist weist auf Gottes Heilswillen hin, der größer ist als alle unsere Schuld.
Im Gleichnis vom verlorenen Sohn zeigt Jesus auf, wie wir Menschen Gott misstrauen und stellt dagegen Gottes große Liebe und Vergebung.
In dem Gleichnis nimmt sich der Sohn von seinem Vater das Erbteil und verlässt ihn. Er dreht sich nicht einmal um. Er vergisst seinen Vater vollständig. Er verprasst das Erbe. Als er kein Geld mehr hat kommt eine Hungersnot. Er verkauft nach und nach alles, was er noch hat. Am Ende ist er völlig verarmt und heruntergekommen und hütet Schweine.
Er darf nicht einmal den Schweinefraß essen, obwohl er hungrig ist. Erst jetzt erinnert er sich wieder an seinen Vater und spricht zu sich selbst: „Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir.“ Dann kehrt er wieder zurück.
Jesus erzählt auch, dass der Vater auf ihn immer gewartet hat. Als er den Sohn zurückkehren sieht, rennt er ihm entgegen und nimmt ihn in seine Arme.
Das Gleichnis Jesu spricht von Schuld und Vergebung. Dabei fängt die Vergebung mit der Einsicht in die eigene Schuld an. „Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir.“
Wir sagen schnell: „Ich entschuldige mich“, wenn wir Unrecht getan haben. Oft wird das so leicht hingesagt. Denn so einfach lässt sich Schuld nicht aus der Welt schaffen. Ich kann mich nicht selbst end-schulden. Es muss mir Vergebung zugesprochen werden.
Als die ehemalige Ministerpräsidentin von NRW, Hannelore Kraft am vergangenen Donnerstag anlässlich des zehnten Jahrestages der Loveparade-Katastrophe im Landtag sprach sagte sie zu den Angehörigen der Opfer gerichtet: „Wir bitten Sie um Vergebung“. Mit solchen Worten besteht zumindest die Möglichkeit, dass eine nicht wieder gut zu machende Situation „heilen“ kann.
„Ich bitte Dich um Vergebung“, das sollten wir auch gegenüber Gott sagen. Es tut mir leid, Gott, dass ich dich nicht Gott sein lasse. Ich bitte Dich um Vergebung, dass ich so oft meine eigenen Wege gehe ohne auf dich zu hören.
Vor Gott können wir auch um Vergebung bitten, wenn wir vor einem Menschen schuldig geworden sind, und das diesem Menschen nicht mehr sagen können, weil er verstorben ist oder an einem uns unbekannten Ort lebt.
Wie anders würde Leben sein, wenn wir uns trauen würden um Vergebung zu bitten.
Unsere Schuld wäre nicht weg. Die Folgen der Schuld sind noch da. Aber es wären Neuanfänge möglich. Es könnten Beziehungen heilen.
Wenn wir Gott um Vergebung bitten, dürfen wir gewiss sein, dass er vergibt, weil er barmherzig ist. Für seine Vergebung können wir ihm nur dankbar sein. Sie ermöglicht uns, unser Leben jeden Tag neu getrost zu leben.
Amen.
Ihr Pfarrer Ernst-A. Schmidt