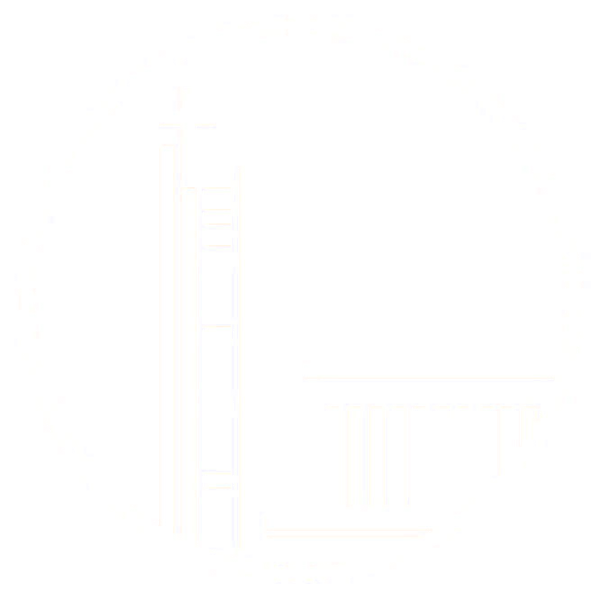Lesepredigt am Sonntag Palmarum, 28. März 2021
Predigttext: Markus 14, 3-9 Die Salbung in Bethanien
Liebe Gemeinde,
die Geschichte, die Sie heute lesen ereignet sich in Betanien, einem kleinen Dorf in der Nähe von Jerusalem. Jesus hat diesen Ort zum Quartier während seines Jerusalemaufenthaltes gewählt. Vor ihm liegt sein schwerer Leidensweg, der ihn wenige Tage später ans Kreuz bringen wird. Zusammen mit seinen Jüngern befindet er sich im Haus eines Mannes mit Namen Simon. Er liegt dort mit seinen Jüngern auf Polstern zu Tisch, den linken Arm aufgestützt. So aß man damals miteinander. Während sie nun miteinander das Essen zu sich nehmen tritt eine Frau in den Raum. In ihren Händen hält sie ein Alabasterfläschchen, oben zugeschmolzen, gefüllt mit dem kostbaren Destillat der wohlriechenden Narde. Die Narde ist eine Pflanze die in Nepal im Himalaja in einer Höhe zwischen 3000 und 5000 Metern wächst.

Eine Salbung während der Mahlzeit und dann noch mit diesem wertvollen Öl ist dagegen ganz ungewöhnlich. Hinzu kommt, dass nun diese Frau in das Gastmahl der Männer eindringt, was man als Frau damals nicht tun durfte.
So ist es klar, dass alle Männer, die da sitzen auf sie und ihr Handeln schauen. Sie werden unwillig. Sie fühlen sich provoziert. Was soll das? Und auch: Was soll diese Verschwendung. Auch wenn das Alabasterfläschchen, das für sich selbst schon einen Wert darstellt, nicht groß gewesen sein mag, so ist doch der Geldwert außerordentlich hoch: 300 Silbergroschen - etwa der Jahresverdienst eines Tagelöhners.
So eine Verschwendung! Man hätte doch das Öl verkaufen und das Geld den Armen geben können. Gehörte doch Almosen geben, beten und fasten zu den gebotenen Verhaltensweisungen frommer Menschen in Israel.
Steht die luxuriöse Salbung nicht in deutlichem Widerspruch zu Jesu Evangelium der Armen? Hat nicht Jesus selbst einmal einen reichen Jüngling aufgefordert seinen Besitz zu verkaufen und Jesus dann nachzufolgen? Es kann doch nicht sein, dass Jesus, der Anwalt der Armen sich mit einem solch teuren Wohlgeruch die Sinne vernebeln lässt!
Kurzum, die Argumente gegen das verschwenderische Tun der Frau sind geradezu erdrückend! Sie steht diesen Argumenten wehrlos gegenüber.
Doch unerwartet findet sie in Jesus ihren Anwalt: „Lasst sie in Frieden! Was betrübt ihr sie? Eine schöne Tat hat sie an mir getan,” sagt er.
Er, der sonst in den Evangelien durchweg als Gebender erscheint, der sich in Wort und Tat tröstend, helfend und vergebend den Menschen zuwendet - ist hier Empfänger von Dank und Ehre, Liebe und Zuwendung. Er setzt die Frau ins Recht. Mehr noch: er gibt ihr für alle Zeiten einen festen Platz in der Verkündigung der Kirche, wenn er sagt „Wahrlich, ich sage euch: Wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat.” (Nachzulesen im Markusevangelium).
Die Frau hat ein gutes, genauer müsste man übersetzen, sie hat ein schönes Werk getan. So wie einer der verliebt ist, gar nicht mehr berechnend über sein Tun nachdenkt, sondern einfach gibt, so gibt die Frau Jesus, im Überfluss.
Der Berechnende sagt: Es hätten doch ein paar Tropfen Nardenöl auf die Füße Jesu gereicht. Dann könnte man den Rest gut verkaufen. Die Liebende gibt einfach, ohne darüber nachzudenken. Während die Jünger faktisch das Gutes-tun an den Armen gegen Schönes-tun an Jesus ausspielen, ordnet sich Jesus in diese Alternativen nicht ein. Auch er sieht die Barmherzigkeit an den Armen als wichtig an, aber sowohl der Dienst an den Armen, wie auch der Dienst an Gott hat je seine konkrete Zeit. „Armen kann man immer helfen, aber wegen meines baldigen Abschieds von euch ist jetzt eine Ausnahmesituation”. Das hat die Frau - im Unterschied zu all den Männern - wohl begriffen.
Die Salbung bekommt angesichts des nahen Leidens und Sterbens Jesu einen höheren Sinn, der der Frau sicher nicht bewusst ist. So wie Könige und Ehrengäste gesalbt wurden, so wurden auch die Toten gesalbt, bevor sie in Leintücher eingewickelt wurden. Jesus deutet die Salbung als die zu seinem Begräbnis vorweggenommene Salbung. Der gesalbte König, geht dem Tod entgegen. In der kommenden Woche werden wir verstärkt an das Leiden und Sterben dieses Königs Jesu denken.
„Man soll Gutes tun”, das haben wir von klein auf gelernt. Darin lebt sich der Glaube aus. Hungrige speisen, Kranke pflegen, Sterbende begleiten, Arme unterstützen, alte Menschen besuchen, für die Wahrung der Menschenrechte eintreten, der Gerechtigkeit und dem Frieden den Weg bereiten. In unserer notvollen Welt sind solche und ähnliche guten Taten notwendig. Wer Gutes tut, handelt vernünftig. Nächstenliebe, Mitmenschlichkeit, Solidarität sind wichtig.
Man soll aber auch Schönes tun. Ein Bild malen, ein Glas Wein aus einem schönen Glas trinken, in die Wolken gucken, Blumen verschenken, jemanden zu einem Frühstück an einem festlich gedeckten Tisch einladen, einen Kuchen für andere backen,
miteinander in Ruhe telefonieren oder besonders schön essen.
Das alles sind einige von den vielen schönen Taten, zu denen uns der Alltag und besonders der Festtag Gelegenheit gibt. Natürlich kann ich auch Essen und Trinken ohne einen geschmückten Tisch und Gottesdienst lässt sich auch ohne Gesang in einer Baracke feiern. Nützlich und notwendig wie die guten Taten sind die schönen Taten nicht. Manchmal erscheinen sie sogar überflüssig. Aber sie machen unser Leben erst besonders, weisen über den Alltag hinaus.
Gerade jetzt, wo uns der bevorstehende Lockdown wieder im Gemüt so herunterdrückt, sollten wir auf die schönen Taten schauen, uns und anderen etwas gönnen.
Die unbekannte Frau aus Betanien hat in ihrer verschwenderischen Liebe zu Jesus Schönes getan. Nüchtern kalkuliert erscheint das als überflüssig. Die Liebe zu Gott, die in der schönen Tat Gestalt gewinnt, kann sich nicht vor der Vernunft rechtfertigen. Doch Jesus rechtfertigt sie!
Er lässt sich die schöne Tat dieser Frau gefallen. So wie er sich der Welt hingibt, in das Leiden hinein, bis zur letzten Konsequenz, dem qualvollen Tode am Kreuz, und damit das Zeichen der Liebe Gottes ist, so ist seine Liebe zu uns auf Wechselseitigkeit angelegt. Seine Liebe ist in dem Maße bei uns angekommen, wie sie unsere Gegenliebe weckt, nämlich die Freude an Jesus. Diese Freude über Gott und seiner Liebe ergreift uns manchmal. Sie fordert uns auf, die selbstvergessene zweckfreie Tat des Lobes und der Anbetung des Christus nicht zu vergessen.
Man soll Gutes tun. Man kann aber auch Schönes tun!
Wann das eine wann das andere „dran” ist kann man nie sicher sagen. Man kann es nur „erspüren.“ Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Karwoche.
Ihr
Ernst Schmidt